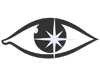geweihte zeit
… Eines Tages fing es an, dass ich immer weniger Verabredungen in meinen Terminkalender notierte. Zeilen, Abschnitte, ganze Seiten blieben leer, bis auf nur wenige belanglose Notizen …
Eine Zeit lang völlig absichtslos sein, Sinn und Zweck nicht kennen müssen. Hören, sehen, spüren. Im Innen und im Außen. Die momentanen Empfindungen des Körpers, die Gefühle, die Gedanken und die Atmosphäre des Raumes, in dem man gerade ist, und wo nichts passiert.
Nicht tun.
Mühelos, ohne etwas zu forcieren – sitzen – auf einem Stuhl, einer Bank, einem Meditationskissen – gehen – an den Ufern eines Sees oder am Rand einer Straße – liegen – auf der Wiese oder auf einer Couch mit Blick in den Garten oder in den Himmel.
Manchmal ist es gut, den Rücken aufzurichten. Wie eine Pflanze, die sich zur Sonne hin ausrichtet, hat es eine ordnende und klärende Wirkung.
… Zunächst hatte ich noch so getan, als würde ich im Terminplan nachschauen müssen, wenn ich um eine Verabredung gebeten wurde. Tatsächlich aber schaute ich weder in meinen Kalender, noch schrieb ich etwas dort hinein. Falls ich zusagte, bewahrte ich es in meinem Gedächtnis auf, und wenn ich es vergaß, war es wohl nicht so wichtig …
Wahrnehmen und nichts verbessern müssen. So wie es in diesem Moment ist, ist es gut. Man könnte sich müde, rastlos, unsicher, liebevoll oder ärgerlich fühlen – alle Zustände und Gefühle sind willkommen und haben die Erlaubnis da zu sein, ohne befürchten zu müssen, bewertet zu werden. Man kann sich selbst fragen: Wie geht es mir? Wie fühle ich mich? Wen oder was finde ich, wenn ich die Augen schließe und in mich hinein spüre? Und man kann diese Fragen restlos ehrlich beantworten. Denn alles darf hier sein, genauso wie es ist, in der Zeit des Nicht Tuns (und natürlich auch sonst).
Wer auf diese Weise mit sich selbst umgeht, gleicht einer Sonne, die mit ihrem warmen Licht alles berührt, was ihr hingehalten wird. Für die Sonne macht es keinen Unterschied, ob sie auf einen Holzstapel oder eine Mülltonne scheint. Sie bewertet nichts, sie bevorzugt nichts, sie schenkt Licht.
Sehen, hören, riechen, es geschieht von allein, man braucht nichts dafür zu tun. Das Ticken einer Uhr, das Rauschen des Windes draußen in dem Bäumen, die zarte Staubschicht auf einer Vase, Licht, das auf den Blättern einer Pflanze glänzt, das Gefühl von Traurigkeit im Bereich des Bauches.
… Die einzige Verabredung, die mir noch wichtig erschien, war die mit der Zeit. Diese Verabredung war es auch, wo ich mich wieder ansammelte, anfing Atem zu haben, anfing Beine zu haben, Arme, anfing eine neue Art von Körper zu haben, der am Ende, das wusste ich, ein Lächeln tragen würde wie eine Krone …
Bemerken, wie Gedanken kommen und gehen. Spüren, wie die Hände den Stoff der Kleidung berühren oder die Armlehne des Stuhles, die kühl und glatt ist. Hören, wie draußen ein Telefon klingelt, sehen, wie die Gardine sich ganz leicht bewegt, fast als würde sie atmen. Bemerken, wie nach und nach mehr Stille einkehrt und nichts passiert. Ein wahrhaftiger Mensch, der einfach da ist.
Man kann dem Nicht Tun täglich ein paar Minuten weihen oder sich längere Zeit darauf einlassen, eine Stunde, einen Tag, zwei Tage. Wie lange auch immer, jede Minute ist kostbar. Niemals verschwendet man seine Zeit, im Gegenteil, man segnet sie.
Ich saß da allein und still für Stunden und es war, als würde ich zum ersten Mal in meinem Leben ankommen.
Am Anfang nimmt man die Stille vor allem in der Abwesenheit von Lärm wahr. In einer leeren Kirche oder in einem einsamen Tal, in der Wüste oder mitten auf einem stillen See. Lässt man sich jedoch für eine längere Zeit auf das Nicht Tun ein, wird man früher oder später noch eine andere Stille kennenlernen. Eine räumliche, kristallklare, tiefe Stille – eher wie eine Präsenz spürbar. Diese Stille ist überall, in jeder Rockfalte, in jedem Blatt, unter jedem Stein, in den Wolken und den Bäumen, in den Pfützen und in den Muscheln, in den Haaren und in den Gedanken, ja selbst zwischen den Gedanken. Sie durchdringt alles, ist unzerstörbar und selbst in dröhnendem Lärm präsent. Überlässt man sich dem Nichts mit ganzem Herzen, lädt dies dieses Vertrauen die Stille ein und irgendwann geschieht es unweigerlich, dass man von ihr berührt wird.
Vor allem, wenn ich längere Zeit in diesem Zustand verweilte, fühlte ich mich irgendwann nicht mehr wie eine Person, die allein in ihrem Zimmer sitzt, sondern wie ein stilles Ding unter anderen stillen Dingen – wie ein ruhendes Tier, inmitten von anderen ruhenden Tieren.
Nicht Tun ist weder ein Konzept noch eine Methode noch eine Strategie. Es sollte möglichst auch nicht zu einer Anwendung werden, also zu etwas, das man tut. Dies erscheint gewissermaßen paradox. Tut man etwas und tut es gleichsam nicht? Tut man etwas, was man eigentlich nicht tun kann? Wie tut man nichts, ohne dass es zu einem Konzept wird? Die Lösung heißt immer wieder aufzuhören:
Wann immer ich merke, dass ich etwas beabsichtige, ein Ziel verfolge oder etwas verändern will, höre ich auf und überlasse mich dem, was mir so nah ist. Das ist die Praxis des Aufhörens, des Aufgebens, des Sich-Überlassens. Sich zu überlassen beinhaltet ein beinahe blindes Vertrauen und dieses Vertrauen ist im Grunde reine Liebe.
Das Leben ist ein scheues Tier.
Wenn ich darauf zugehe, weicht es zurück und versteckt sich,
wenn ich es auffordere herauszukommen,
oder versuche es einzufangen, bleibt es versteckt.
Selbst wenn ich die schönsten Tänze aufführe und Lobreden halte, um es zu beeindrucken, wird es sich nicht sehen lassen.
Nur wenn ich still bin und nichts tue,
nichts um es zu überreden,
nichts um es herzuholen,
nichts um es zu manipulieren,
kommt es ganz langsam heraus und offenbart sich.
Am Ende werde ich in seinen Armen liegen wie ein Kind.
©Rani Kaluza
„Es ist nicht notwendig, dass du aus dem Haus gehst. Bleib bei deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders, verzückt wird sie sich vor dir winden.“
– Franz Kafka